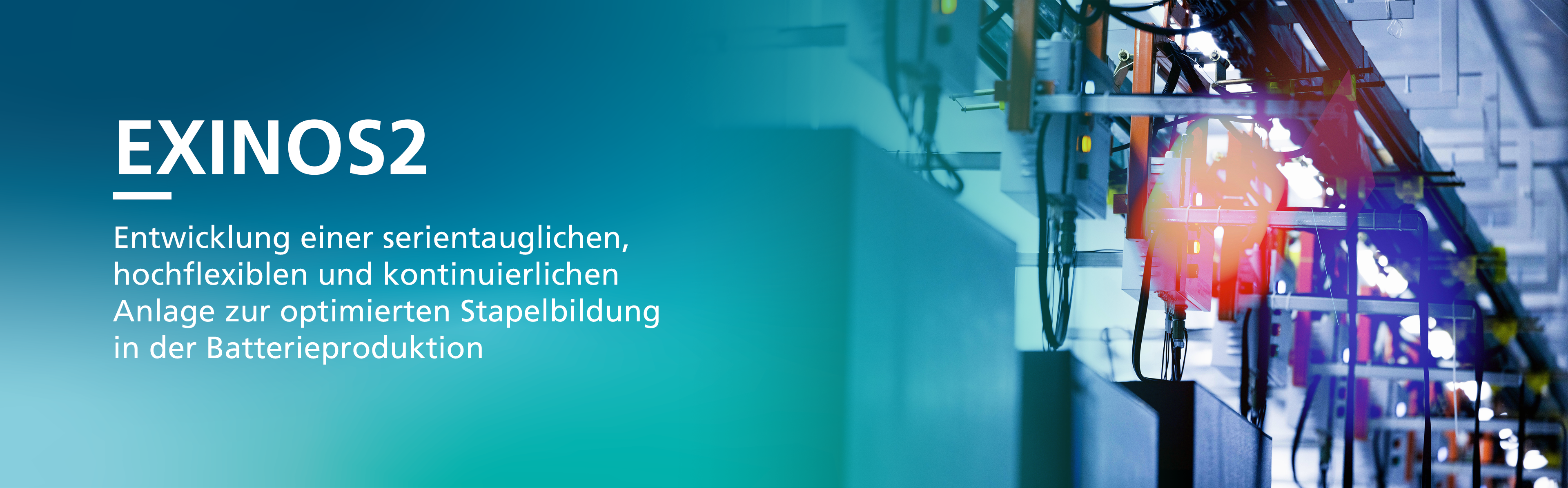EXINOS2
EXINOS2 – Entwicklung einer serientauglichen, hochflexiblen und kontinuierlichen Anlage zur optimierten Stapelbildung in der Batterieproduktion
Im Projekt EXINOS2 soll der Technologiereifegrad eines bereits umgesetzten prototypischen und innovativen Maschinenkonzepts (gen. EXINOS), zur flexiblen und kontinuierlichen Stapelbildung, erhöht werden. Hierbei soll die Anlage zu einem funktionsfähigen System weiterentwickelt und in einer Realitätsnahen Produktionsumgebung erprobt werden. Die Anlage zielt darauf ab, den Prozessschritt der Stapelbildung hinsichtlich Flexibilität, Durchsatzstärke und Footprint signifikant zu optimieren.
Dem Prozessschritt der Stapelbildung wird innerhalb der Batterieproduktionskette eine hohe Bedeutsamkeit zugesprochen. Nicht zuletzt, da hier i. d. R. ein Wechsel von einer kontinuierlichen zu einer diskreten Prozessführung stattfindet, resultieren daraus Herausforderungen wie eine erhöhte Fehleranfälligkeit, komplexe Handhabungsprozesse und erschwerte Aufwände bzgl. der Intralogistik. Die bislang eingesetzten „Pick & Place“-Systeme sind hinsichtlich des Durchsatzes und der zu produzierenden Zellformate limitiert.
Aus diesem Grund sollen die Vereinzelungs-, Reinigungs-, Verbundaufbau-, Stapelbildungs-, Bahnführungs- und Handhabungsmodule technisch optimiert, untereinander abgestimmt und durch ein skalierbares Steuerungs-Framework zusammengeführt werden. Parallel wird ein Digitaler Zwilling entwickelt, der die virtuelle Inbetriebnahme ermöglicht, Betriebsdaten auswertet und virtuelles Condition-Monitoring unterstützt.
Die Maschine soll in die Infrastruktur der Forschungsfertigung integriert und unter realen Produktionsbedingungen erprobt werden. Begleitendes Projekt- und Wissensmanagement stellt eine fristgerechte Zielerreichung sicher und bereitet die entwickelten Methoden als Blaupause für zukünftige Industrialisierungsvorhaben in der Batteriezellfertigung auf.
Arbeitsplan
Der Arbeitsplan umfasst sechs Arbeitspakete:
AP 1: Ausgehend von Markt- und Technologieanalysen werden Anforderungen an Durchsatz, Flexibilität, Footprint sowie physische und digitale Schnittstellen einer serientauglichen Stapelmaschine definiert. Dazu zählen die Integration in industrielle Prozessketten mit IIoT/MES-Anbindung und die Spezifikation des digitalen Zwillings. Aus dem EXINOS-Konzept werden gezielte Optimierungen für Vereinzelungs- und Stapelbildungstechnologien abgeleitet.
AP 2: Auf Basis der Anforderungen aus AP1 wird das Gesamtanlagenkonzept erstellt. Materialfluss, Teilprozesse (Vereinzeln, Reinigung, Verbundaufbau, Stapelbildung, Bahnbführung, Handhabung) sowie Mess-, Antriebs- und Steuerungstechnik werden ausgelegt und zu einem industriefähigen System verknüpft. Prototypische Tests einzelner Module sichern Leistungsfähigkeit, Prozessstabilität und digitale Integrationsfähigkeit.
AP 3: Es wird ein modellbasierter digitaler Zwilling entwickelt. Nach Definition der Anforderungen, Schnittstellen und Entwicklungspipeline entstehen physikalische Teilmodelle, die gekoppelt für virtuelle Inbetriebnahme und Parameteroptimierung genutzt werden. Die Echtzeit-Anbindung an SPS- und Edge-Systeme ermöglicht Optimierungen für Entwicklung, Inbetriebnahme und Betrieb.
AP 4: Aufbau der in AP2 entwickelten Module zur Gesamtanlage in der FFB unter Sicherstellung physischer und digitaler Kompatibilität mit der bestehenden Infrastruktur.
AP 5: Validierung der Gesamtanlage durch Versuchskampagnen (Stapel- und Vollzellenaufbau, Qualitäts- und elektrochemische Tests). Die Ergebnisse werden mit dem digitalen Zwilling abgeglichen. Daraus abgeleitete Optimierungen werden in der Anlage umgesetzt, um Effizienz und Leistungsfähigkeit zu steigern.
AP 6: Projektbegleitung mit kontinuierlicher Zielüberprüfung. Das erworbene Know-how wird als Blaupause für künftige Transferprojekte und Industrialisierung prototypischer Anlagen aufbereitet.
Ergebnisverwertung
Das Projektkonsortium vereint die wissenschaftlichen Kapazitäten der Fraunhofer FFB und dem wbk Institut für Produktionstechnik des KIT mit der industriellen Er-fahrung von acp, BST, Schmalz und Siemens. Durch die sich ergänzenden Kompetenzfelder des Projektkonsortiums sind sämtliche für Errichtung, Weiterentwicklung und Realisierung benötigten Kompetenzen abgedeckt. Im Fokus steht die Optimierung des Stapelbildungsprozesses, der weiterhin ein großes Verbesserungspotenzial bietet.
Bis Projektende 2027 soll eine einsatzreife Anlage entwickelt und patentseitig abgesichert werden. Um den Batterieproduktionsstandort Deutschland langfristig etablieren und stärken zu können werden strategische Optionen für Vertrieb und Weiterentwicklung geprüft. Hierdurch können dem deutschen Anlagenbau, den Komponentenherstellern und den Digitalisierungs-Enablern nachhaltige Wettbewerbsvorteile verschafft werden.